Das Leben auf der Erde kann man durch drei Eigenschaften beschreiben:
- Selbstreproduktion,
- Metabolismus und
- Mutagenität
Einige dieser Eigenschaften kann man den beiden uns bekannten Systemen zuschreiben, so sind Nucleinsäuren zur Selbstreproduktion fähig und weisen Mutagenität auf, haben aber nicht die Möglichkeit eines Stoffwechsels. Dementgegen haben die Koazervate und Mikrosphären diesen Stoffwechsel, aber sind weder der Mutation noch der Selbstreproduktion fähig. Wir sehen, dass wir diese beiden Systeme kombinieren müssen um der Definition von Leben gerecht zu werden.
Die Kompartimentierung, d.h. der Einschluss von Nucleinsäuren in geschlossene Reaktionsräume, ist ein wichtiger Schritt zu dieser Synthese. Um diese beiden Systeme kompatibel zu machen, haben sich die Hyperzyklen entwickelt, die sich durch Einlagerung in Mikrosphären kompartimentiert haben. Der Hyperzyklus, der sich bis heute erhalten hat und der Selbstreplikation mit dem kleinsten Energieaufwand und über die wenigsten Zwischenstufen möglich macht, besteht aus den Teilschritten Transkription und Translation, er brachte den genetischen Code und die Ribosomen hervor, sowie der Replikation (der DNA).
Nun existierte der Hyperzyklus in einer Mikrosphäre, die sich nur begrenzt lange halten konnte bis sie sich in kleinere Tröpfchen aufspaltete. Sie hatte einen primitiven Stoffwechsel, der ihr Überleben eine zeitlang sicherte und ihre Wand verstärkte.
Nun gibt es zwei Formen des Überlebens:
a) die kurzfristige Form, bei der Stoffe aus der Umwelt aufgenommen, umgewandelt und als Bausubstanz und zur Energiegewinnung Verwendung finden,
b) die langfristige Form, bei der alle Eigenschaften identisch an eine nachfolgende Generation weitergegeben werden und dadurch das Überleben der Information erreicht wird.
Entwicklung eines Stoffwechsels
Nun traten aber in den kompartimentierten Hyperzyklen Mutationen auf, und es werden sich per Zufall Hyperzyklen entwickelt haben, die anderen überlegen waren. So zum Beispiel ein Hyperzyklus, der Informationen enthält, wie man für das Kompartiment (die Zelle) wichtige Stoffe aus ihren Vorstufen synthetisieren kann. Denn wir müssen uns vor Augen halten, dass der Vorrat an Nucleosiden, Aminosäuren und anderen Stoffen nicht uneingeschränkt war. In heutigen Zellen - und hier müssen wir wieder von dieser Annahme ausgehen - werden diese Stoffe durch eine Mehrschrittsynthese gebildet. Ein Schema kann folgendermaßen aussehen:
A > B > C > D > E
wobei A der Ausgangsstoff und E das Endprodukt sein sollen. Alle Zwischenprodukte sind für die Zelle nicht nutzbar, sie werden lediglich weiterverarbeitet. Aber was heißt das für die Evolution eines Stoffwechsels? Dass das Vorhandensein eines Stoffes nur dann von Vorteil ist, wenn er sich weiterverarbeiten lässt. Demzufolge müssten sich die Schritte rückwärts aufgebaut haben - diese These stellte Norman H. Horowitz auf.
1. D > E (weil E nicht mehr ausreichend verfügbar war),
2. C > D (weil auch D langsam verschwand) usw.
Die Hyperzyklen mussten also dafür sorgen, dass ihre Ausgangsstoffe in ausreichender Zahl zur Verfügung standen, auch wenn sie dabei Vorstufen umwandeln mussten. Für jeden dieser Schritte ist ein Enzym verantwortlich, das spricht für die Ein-Gen-ein-Enzym-Hypothese.
Diese Umwandlungsprozesse setzten in noch stärkerem Maße einen geschlossenen Reaktionsraum voraus, denn die Stoffe, die möglicherweise unter Energieverbrauch erzeugt wurden, können wegdiffundieren und das würde den Hyperzyklus auslaugen, wenn er wieder Energie aufwenden müsste. Als früheste Reaktionsräume dieser Art könnten, wie unter Makromoleküle verdeutlicht, Spalten in Gesteinen oder Tonmineralien gedient haben, später sind die Mikrosphären wahrscheinlich relevanter gewesen.
Entwicklung erster Membranproteine
Ab dieser Stelle der Entwicklung kann es passiert sein, dass die Evolution nicht mehr ausschließlich durch Mutationen verursacht wurde, die Replikation der Nucleinsäuren wurde ja immer genauer, sondern dass es hier zur Anhäufung von Leistungen verschiedener Kompartimente und damit Enzymen kam, das die Evolution nach dem Baukastenprinzip neue Proteine erstellte. Möglich macht das die Fusionsfähigkeit der Mikrosphären. Im Zuge dieser Entwicklung könnten auch die Membranproteine, die die Interaktion der Zellen heute möglich machen, entstanden sein. Schließlich musste eine Mikrosphäre, oder Protozelle erkennen, ob die andere die Leistungen erbringt, die sie benötigt. Es konnten also Unterscheidungen zwischen gleich, komplementär und fremd getroffen werden, die Hyperzyklen in den Sphären machten sich also nach außen bemerkbar, lax könnte man sagen: Sie boten ihre Qualitäten an und fragten gleichzeitig nach bestimmten Leistungen anderer.
Einige Hyperzyklen könnten außerdem Stoffe produziert haben, die die Wand der Mikrosphäre verstärkt und somit zu ihrem Wachstum beigetragen haben. Teilten sich die mikrosphären dann, konnte den Tochtertröpfchen die Erbinformation mit auf den Weg gegeben werden und so könnten die ersten vermehrungsfähigen Protozellen entstanden sein. Um die Integration eines Hyperzyklus' in eine Mikrosphäre weiter zu erhöhen, könnte man sich ein Eingreifen des Hyperzyklus' in den Stoffwechsel der Mikrosphäre vorstellen.
 |  |
| Abb. 1.1: Linearer Stoffwechselweg | Abb. 1.2: Variabler Stoffwechselweg |
Einen Beweis für diese Art des Baukastenprinzips und die Interaktion von Protozellen finden wir durch die Rekonstruktion von Stoffwechselwegen. Einige sind lediglich linear, d.h. alle Glieder werden hintereinander durchlaufen. Die Mehrzahl der Stoffwechselvorgänge ist allerdings variabel, d.h. hier können Kettenreaktionen durch bestimmte Substanzen abgebrochen oder verzweigt werden. Dies ist sehr wichtig zur energiesparenden Bereitstellung von wichtigen Stoffen. Es kann also je nach Bedarf die Produktion eines Stoffes forciert (und die eines anderen blockiert) werden.
Die Evolution der Enzyme
 |
 |
| Abb. 2.1: Enzym aus einer Untereinheit | Abb. 2.2: Enzym aus mehreren Untereinheiten |
Hinter solchen Zweig- oder an den Abbruchstellen stehen oft regulierbare Enzyme, das sind Enzyme, die aus mehreren Untereinheiten bestehen und durch gewisse Substanzen "an- oder ausgeknipst" werden können. Solche Enzyme sind offenbar aus der Kombination von bestimmten Genabschnitten (bei Eukaryonten und Archäbakterien aus Exons) entstanden. Im unteren Schaubild (Abb. 3) können Sie einige solcher Enzyme sehen.
Nicht regulierbare Enzyme bestehen aus einer Einheit (Abb. 2.1) und setzen, sobald sie ein entsprechendes Substrat binden, das Substrat ihrer Funktion entsprechend um. Das Problem hierbei ist, dass gewisse Substrate als Ausgangsstoff für andere Synthesen gebraucht werden. Hier würden sich die Enzyme gewissermaßen gegenseitig die Substrate wegschnappen, was zu einer Beeinträchtigung der Lebensvorgänge führt. Um das zu umgehen, könnten die Enzyme nur nach Bedarf produziert werden und müssten nach Erfüllung ihrer Funktion zerlegt werden. Da das sehr energieaufwendig ist und dieser Prozess nicht schnell genug reagieren kann, haben sich regulier- und damit abschaltbare Enzyme durchgesetzt.
Regulierbare Enzyme bestehen alle aus einer funktionellen Einheit (Apoenzym) und Untereinheiten, die meist der Substraterkennung dienen. So sieht man, dass die Enzyme miteinander verwandt sind. Wahrscheinlich wurden auf dem Höhepunkt ihrer Perfektion durch Genkombination die anderen Abschnitte angefügt. Da sich die Enzyme dann kaum noch weiterentwickeln (mutieren), können die einzelnen Untereinheiten bequem miteinander kooperieren. Würden sich die Strukturen der einzelnen Untereinheiten ändern, wäre eine Kooperation nicht mehr möglich.
In eukaryotischen Zellen werden Proteine mit verschiedenen Untereinheiten (Domänen) durch sogenanntes alternatives Splicing realisiert: In Eukaryoten liegen Gene mosaikartig vor, sie bestehen aus kodierenden (proteinerzeugenden) Abschnitten(Exons) und nicht-kodierenden Introns, welche in er Regel durch Splicing herausgeschnitten werden. Zusätzlich zu den Introns können auch kontrolliert Exons herausgespleißt werden, es können also alle von einem Enzym nicht benötigten Untereinheiten (die bspw. verschiedene Substrate binden) entfernt werden, und nur das Exon für ein spezielles Substrat bleibt erhalten. Ein Gen kann also einen kompletten "Proteinbaukasten" enthalten, aus dem durch Spleißen ein konkretes, z. B. substraspezifisches Protein erzeugt werden.
Einige Enzyme arbeiten mit Hilfe von verschiedenen Coenzymen. Dies sind zum Beispiel Vitamine (deshalb sind sie so wichtig) oder auch Nucleotide. So ist das Apoenzym im unteren Schaubild der Teil, der NAD+ bindet. Diese Verbindungen weisen einen Zusammenhang oder eine nebeneinander verlaufende Entwicklung der Enzyme aus. RNA-Moleküle können auch katalytische Funktionen übernehmen, das wurde im Abschnitt der Selbstreplikation schon besprochen. Sie waren wahrscheinlich die ersten Katalysatoren, die bei der Replikation von Nucleinsäuren halfen. Durch die modernen Enzyme wurden sie abgelöst, einige Teile haben sich aber erhalten. Beim Reifungspozess der mRNA in eukaryontischen Zellen schneiden zum Beispiel Ribozyme die Introns heraus.
| Untereinheit | Apoenzym | Untereinheit(en) | Enzymname |
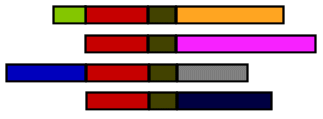 |
LDH: Lactatdehydrogenase | ||
| GAPDH: Glycerinaldehydphosphatdehydrogenase | |||
| L-ADH: Lösliche Alkoholdehydrogenase | |||
| MDH: Malatdehydrogenase | |||
| Abb. 3: Kombinierte Quartärstrukturen in Enzymen, die Untereinheiten sorgen für Substratspezifität | |||
Ein weiteres Beispiel für Proteine aus mehreren Untereinheiten, die aber keine Enzyme sind, sind die Globine. Sie transportieren in speziellen Taschen die Sauerstoffmoleküle bei allen atmenden Organismen. Im menschlichen Blut ist es das Hämoglobin, in Pilzen das Myoglobin und in Pflanzen (Leguminosen) das Leghämoglobin. Es ist dafür verantwortlich, in den Wurzeln sauerstofffreie Bereiche zu schaffen, damit dort die Stickstofffixierung möglich ist. Diese Struktur Eiweiße kann wohl kaum durch Zufall in den verschiedenen Zellgruppen, die sich sehr früh voneinander trennten, entstanden sein, viel wahrscheinlicher ist, dass eine Struktur abgewandelt wurde.
Aus der Analyse von Struktur und Funktion der Proteine konnte man die Evolution der Hyperzyklen besser verstehen, denn wo Gene kombiniert werden, müssen Zellen und deren Erbmaterial interagieren.
Am Ende ist genau das entstanden, was wir als lebendig bezeichnen: ein in sich abgeschlossenes System, dass zu einem Stoffwechsel und zur Weitergabe seiner Erbinformationen fähig ist. Mutagenität ist auch gewährleistet, einmal durch die Kombination verschiedenen Erbmaterials und durch Mutation. Besser angepasste Protozellen konnten sich so besser vermehren als weniger angepasste. Die Evolution durch Selektion im Darwinschen Sinne konnte die Gesamtheit des Zellkomplexes bewerten.
Zurück | Vorwärts