Das Leben ist heute untrennbar an Zellen gebunden, sie stellen die kleinste Einheit des Lebens dar. Sicherlich sind die Vorteile des Einschlusses in Zellen einleuchtend:
- Zellen schützen vor schwankenden Umweltbedingungen,
- Zellen bzw. ihre Membranen bieten den Vorteil, Konzentrationsgradienten aufrecht zu erhalten.
Die RNAs brauchten diese Vorteile nicht, denn sie waren es ja quasi gewöhnt, im freien Wasser zu leben. Konzentrationsgradienten sind heute hauptsächlich zum Stofftransport und zur Energieerzeugung nötig, die Quasi-Spezies und Hyperzyklen selbst konnten weder Stoffe transportieren noch Energie erzeugen. Nein, wie im vorigen Kapitel angedeutet, hatte die räumliche Trennung von Hyperzyklen einen anderen entscheidenden Vorteil: die Bewertung des Genotyps einer Quasi-Spezies, also ihrer Gene. Da die Darwinistische Selektion nur phänotypische Auswahl treffen kann, ließ sich das Problem dieser Zweiten Informationskrise nicht durch Wettbewerb lösen. In Abbildung 3.2 des vorigen Kapitels sieht man, dass ein weniger leistungsfähiges Gen nicht ausgesondert werden kann und dadurch die Effizienz des gesamten Systems drückt. Durch Kompartimentierung lässt sich Abhilfe schaffen.
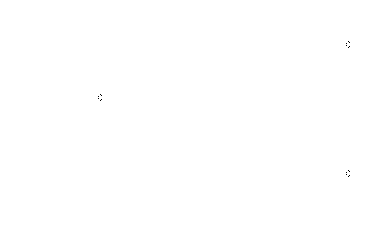 |
In diesem Schaubild soll I für die gesamte Information stehen, es können auch mehrere Informationsträger I1, I2 ... In durch einen Hyperzyklus gekoppelt sein. Dabei ist aber zu beachten, dass alle Erbteile korrekt weitergegeben werden und der Hyperzyklus nicht zum Erliegen kommt. Sonst würde sich im Innern des Kompartiments wieder Wettbewerb um die energiereichen Monomere auftreten und das Kompartiment ist nicht lebensfähig. Hier ist in einem Kompartiment I eine Mutation aufgetreten. Das Kompartiment zerfällt sofort danach in zwei Tochterkompartimente, von dene eines gleich dem Ausgangskompartiment ist, das andere jedoch den Mutationsfehler mit sich trägt. Im Wettbewerb zwischen beiden Kompartimenten um Energie, Baustoffe, schnellstmögliche Vermehrung und um Stabilität wird sich nun zwischen ihnen beiden und ihren jeweiligen Nachkommen entscheiden, welches die besseren Erbanlagen trägt. |
Wenn in einem Kompartiment, also einem Hyperzyklus eine Mutation auftritt und sich danach zwei Kompartimente bilden, eine alte und eine mutierte Version, dann kann hier der Darwinsche Wettbewerb von Kompartimenten beginnen. Er beschreibt, dass nur das tauglichste aller Kompartimente überlebt. Hier werden die Kompartimente als eine funktionelle Einheit gesehen, d.h.
- ein gut funktionierender Hyperzyklus,
- gute funktionelle Proteine (Enzyme),
- gut angepasste Strukturen der RNA, die eine hohe Stabilität und Replikationswirkung hatten sowie
- ein leistungsfähiger Genotyp der gekoppelten Quasi-Spezies.
Das Kompartiment hat außerdem den Vorteil, dass benötigte Stoffe und Reaktionspartner auf kleinem Volumen konzentriert sind und Reaktionen demzufolge schneller ablaufen. Die Diffusion von Molekülen wird wirksam verhindert.
Entwicklung leistungsfähiger Polymerasen
In diesen Kompartimenten werden also sowohl die Enzyme selbst besser geworden sein, die eine genauere Replikation von RNA-Molekülen möglich machten - es könnten hier die Polymerasen entstanden sein - als auch die Translationsmaschinerie entstanden sein, die viele Enzyme zusammensetzen konnte. Hier hat sich also die Genauigkeit der Replikation erhöht, was längere Gene zulässt, was wiederum bessere Enzyme möglich macht. Auf diese Weise werden irgendwann auch Enzyme oder Strukturen entstanden sein, die die Translationsmaschinerie bildeten.
Der heutige Translationsapparat - Ribosomen
Heutige Ribosomen, also der Translationsapparat, bestehen aus einer speziellen RNA, der rRNA, deren Aufgabe es ist, mRNA (die Kopie der DNA) in Proteine zu übersetzen. Denkbar ist es, dass an diese rRNA bestimmte Enzyme gebunden waren, die die zugehörigen Aminosäuren zu langen Ketten, den Proteinen verbanden. Irgendwann wird auch die tRNA ins Spiel gekommen sein, die zu einem Triplett die passende Aminosäure findet. Beide RNAs (t- und rRNA) müssen im heutigen System sehr genau zusammenarbeiten, dazu müssen sie in ihrer Struktur genau aufeinander abgestimmt sein, ebenso entwickelten sich die Enzyme.
Probleme in Kompartimenten
Um die Kompartimente gegeneinander abzugrenzen, musste zunächst eine geeignete Hülle gefunden werden. Zellmembranen, die diese Aufgabe heute übernehmen, bestehen aus langen Ketten von Lipiden und Proteinen. Um diese Strukturen nachzubilden, sind heute ganze Komplexe von Enzymen und viele chemische Reaktionen notwendig, sodass man davon ausgehen kann, dass es früher entweder primitivere oder einfach nur zufällige Ummantelungen gegeben hat. Im Abschnitt "Koazervate und Mikrosphären" möchte ich näher auf diese Problematik eingehen.
Weitere Probleme ergeben sich aus der Tatsache, dass die zur Replikation und zur Translation benötigten Substanzen, wie energiereiche Monomere oder Aminosäuren, erst aus der umgebenden Ursuppe in das Kompartiment geschleust und dafür gegebenenfalls ihre chemische Struktur geändert werden musste. Dies alles muss ich also nebeneinander oder durch viele glückliche Zufälle entwickelt haben, doch das herauszufinden, wird sehr schwierig sein, da wir hauptsächlich von den heute lebenden Zellen ausgehen können.
Weiterer Ausblick
Die Kompartimente mussten, damit die oben beschriebene Evolution stattfinden konnte, ihre Erbanlagen an ihre Tochterkompartimente weitergeben. Es ist einerseits vorstellbar, dass durch Diffusion RNA-Quasi-Spezies und der Replikations- und Translationsapparat in die sich teilenden Kompartimente hineintransportiert wurden. Hier musste allerdings sichergestellt werden, dass die Kompartimente vollständig waren, d.h. alle Quasi-Spezies in die neuen Kompartimente gelangten, weil ansonsten das gesamte Kompartiment nicht lebensfähig gewesen wäre.
Die zweite Möglichkeit wäre, wie weiter oben erwähnt, dass es zu diesem Zeitpunkt die DNA samt ihrer DNA-Polymerasen schon existierte. Durch die erheblich größeren Genlängen und die extrem erhöhte Kopiergenauigkeit, würde hier nur ein einziger Erbträger weitergegeben werden müssen. Die DNA kann sich durch ihre Enzyme verhältnismäßig leicht replizieren und so das Fehlen einer Information in einem der Kompartimente nahezu auf Null verringern. Hier muss man aber anmerken, dass eben diese genaue Replikation eine Mutation sehr unwahrscheinlich macht.
Zurück | Vorwärts